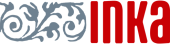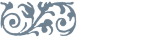Biss zur letzten Rübe – der reinste Genuss (Juli 2021)
Stadtleben // Artikel vom 07.07.2021
Völlerei. Butterkur mit Onka
Wohl gab ich ihr recht, mich und die Einkaufstaschen das Treppenhaus hochschleppend, wandte aber ein, dass während meiner Zeit im Münchener Jugendamt bereits ab ca. 14.30 Uhr meine Arbeitsleistung rapide nachzulassen begann; um 14.30 Uhr nämlich kehrten wir gewöhnlich zum zweitem Mal aus dem Biergarten zurück, vom Mittagessen, nachdem wir bereits vormittags, wie es Sitte ist, ein Weißwurstfrühstück dortselbst eingenommen hatten. „Arbeitsleistung? Verkommener Spießer!“, schimpfte sie. Die meisten von Menschen verursachten Katastrophen seien durch ein Zuviel an Arbeitsfleiß hervorgerufen worden: Grabenkriege, Kolonialherrschaft und Verkehrskontrollen. Ich widersprach nicht. Da es fürs Lunch noch zu früh war, beschloss Onka, ein zweites Frühstück zuzubereiten, eine jener basiskulturellen Errungenschaften, die ebenfalls verloren zu gehen drohten. Behutsam zerfetzte sie sechs Hühnereier und zerließ ein halbes Pfund Butter, ein dunkelgelbes Hochalm-Erzeugnis, in Pfanne eins. Im Umkreis von 500 Kilometern komme keine andere ihr gleich; höchstpersönlich führe sie der Käsehüttenwirt aus den Alpen ein. Beim Beschmieren des frisch gebackenen Vinschgauer Brotes, das uns die Wartezeit ertragen half, verfuhr meine Gastgeberin wiederum nach dem Generositätsprinzip.
Sehr langsam nur stockte das Rührei, was uns die Gelegenheit gab, ein paar Speckstreifen auszubacken. Wir futterten in der Küche. Es gab den berühmten tiefschwarzen Onka-Kaffee dazu und zwei Obstbrände, auch dies einer Tradition folgend: Zum „Nüni“ (es war schon 11) gehört nun mal Schnaps, daran konnten auch wir nichts ändern. Nun wurde es Zeit, sich ins Speisezimmer zu begeben. Während Onka ihre Töpfe verhöhnte, sie seien Billigware, las ich die Morgenpost und verzehrte etwas Käsegebäck, akkompagniert von ein paar Gläschen Muskateller. Endlich tischte sie auf. Manch einem wäre das Menü allzu unsommerlich erschienen, mir aber war die pädagogische Absicht klar, also fügte ich mich und schwitzte ordnungsgemäß. Einer Vichyssoise mit schön viel Rahm folgte dicke Rippe mit Backpflaumen und Bohnen, dazu ein Kartoffelstampf, der wiederum davon zeugte, wie sehr es Onka um Ausgewogenheit zu tun war, also die Verwendung von Almbutter betreffend. Die Sauce Café de Paris passte nicht ganz, schmeckte aber vorzüglich, der Butter wegen. Wir tranken viel Starkbier, nahmen eine zweite Portion und verzichteten aufs Dessert.
„Und? Wird´s besser?“, erkundigte sich Onka, indem sie mich ins Herrinnenzimmer hinüber bat und Zigarren reichte, heimische, aus badischem Geudertheimer gefertigt. In Erinnerung an Manns Zauberberg blieben wir beim Starkbier, nur auf den Pelzsack verzichten wir. Sie schenkte Armagnac ein, dozierte über die grassierende „Entspannungsverkrampfung“ und versprach, „bis zum letzten Atemzug“ dagegen zu opponieren. Der schien nahe zu sein, nachdem wir den Nachmittagskaffee eingenommen hatten, in Gesellschaft von Bienenstich und dick gefüllten Windbeuteln. Doch nun trat etwas Sonderbares ein: Ich bekam langsam Appetit. Meine Gastgeberin gratulierte mir zu meiner Heilung und machte sich Vorwürfe: Wir hätten noch viel zu wenig Wein gesoffen! Dies änderten wir sogleich, und bei einer frugalen Vesper mit Schopfspeck, Meerrettich und Butterbrot planten wir das Abendmenü. Es war der Almbutter gewidmet, die in jedem Gang vorkommen sollte. Den genauen Ablauf habe ich nicht mehr im Kopf, ich weiß nur noch, dass ein hochreifer Chaource, den wir zum Burgunder nahmen, den Abschluss machte. Dazu gab es, ganz schlicht, etwas gebuttertes Baguette. Man will ja nicht übertreiben.
WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL
Laden Zwei: Closing & Event-Samstage
Stadtleben // Artikel vom 17.01.2026
Sie ist das Weststadt-Aushängeschild für „Faire Mode, Accessoires & kreative Geschenke“ von der Kunstkarte bis zur Mietbox für handgemachte Produkte.
Weiterlesen … Laden Zwei: Closing & Event-SamstageBauernmarkt Karlsruhe
Stadtleben // Artikel vom 08.01.2026
Winterpausenlos gibt es bei diesem Monatsmarkt am ersten Donnerstag auf dem Schlachthof die Region direkt vom Erzeuger in den Einkaufskorb.
Weiterlesen … Bauernmarkt KarlsruheFünf: Menüreihe „Begegnungen“
Stadtleben // Artikel vom 21.12.2025
Mit seiner im November gestarteten Sonntagsmenüreihe „Begegnungen“ animiert das Nordstadtrestaurant Fünf, über den Tellerrand zu schauen.
Weiterlesen … Fünf: Menüreihe „Begegnungen“Magasin Madagascar: Weihnachtsladen 2025
Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025
Während die Vanille- und Pfefferinsel mit einer neuerlichen Übergangsregierung in der schwersten Staatskrise seit Jahren steckt, wird das seit 2010 im Atelier für Gestaltung eröffnete „Magasin Madagascar“ bei der kommenden Winteredition erstmals zum „Weihnachtsladen“.
Weiterlesen … Magasin Madagascar: Weihnachtsladen 202516. Karlsruher Weihnachtscircus
Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025
„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“
Weiterlesen … 16. Karlsruher WeihnachtscircusWundertüte 2025
Stadtleben // Artikel vom 12.12.2025
Früher war mehr „Lametta“, aber was da jetzt wohl drinstecken mag?
Weiterlesen … Wundertüte 2025Klunker für Uschi #16
Stadtleben // Artikel vom 12.12.2025
Parallel zum neuen Kunst- und Designmarkt „Wundertüte“, der im Tollhaus die „Lametta“-Nachfolge antritt, präsentiert die „Uschi“ am dritten Adventswochenende zum 16. Mal ihre „Klunker“ im Rahmen einer kleinen, feinen Weihnachtsausstellung.
Weiterlesen … Klunker für Uschi #16Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025
Stadtleben // Artikel vom 11.12.2025
Die Mischung macht’s!
Weiterlesen … Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025
Stadtleben // Artikel vom 11.12.2025
Seit 2009 ist die „Karlsruher Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst und Kunsthandwerk“ fester Bestandteil der Ausstellungen im Regierungspräsidium am Rondellplatz – und präsentiert sich traditionell wie innovativ, facettenreich und immer wieder neu!
Weiterlesen … Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025